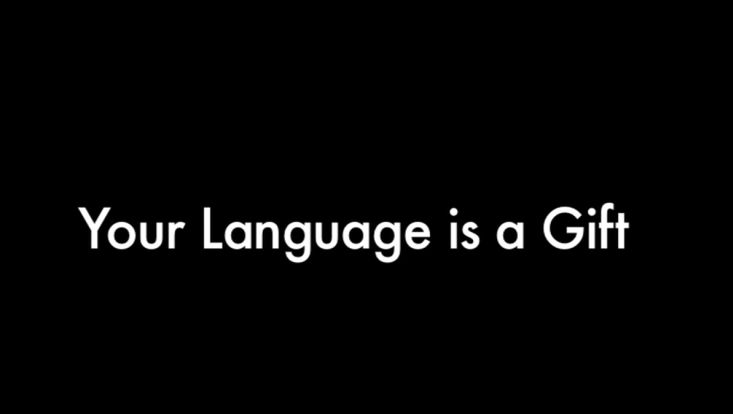Mehrsprachige Geschichten
Hier können Sie einen Einblick in die Erfahrungen und Erlebnisse unterschiedlicher Menschen mit Mehrsprachigkeit bekommen. Möchten Sie uns auch Ihre mehrsprachige Geschichte erzählen? Schreiben Sie uns gern(kombi"AT"uni-hamburg.de), wir würden uns freuen!
Russisch lernen als Erwachsene: Wie ich meine Muttersprache wiederfand
Eine junge Journalistin beschreibt sehr anschaulich, wie ihr Weg zur Anerkennung ihrer Mehrsprachigkeit verlaufen ist. Den Beitrag finden Sie hier.
„Voice Versa – Zwei Sprachen, eine Story“: Podcast von Deutschlandfunk Kultur und Goethe-Institut
In dem gemeinsamen Podcast von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut erzählen Zehn Autorinnen Geschichten aus einer mehrsprachigen deutschen Gesellschaft. Es handelt sich um persönliche Geschichten und Erfahrungen der Autorinnen. So gelingen Einblicke in den Alltag einer geflüchteten Frau in Berlin, die Bedeutung der Sprache von Vätern und Müttern und Bedeutung von kolonialer Vergangenheit. Auch Themen wie Jobsuche, Dating, Drogen, Deutschlernen und Erziehung finden im Podcast Raum.
Der Podcast startet am 13.04.2021 mit den ersten zwei Episoden in der DLF-Audiothek und auf allen gängigen Pdcast-Plattformen.
Weitere Folgen erscheinen im Turnus von zwei Wochen und zusätzlich einmal im Monat als Doppelfolge in der Sendung "Feature" in Deutschlandfunk Kultur.
Erfahrungen einer mehrsprachigen Familie - eine Mutter erzählt, wie ihre Kinder mit vier Sprachen aufgewachsen sind
Wir sind eine mehrsprachige Familie. Ich spreche Bulgarisch, mein Mann kommt aus Kanada und spricht Französisch (Quebecois). Unsere Kinder sind mit den Sprachen Bulgarisch, Französisch, Englisch und Deutsch aufgewachsen. Dabei sprechen mein Mann und ich unsere jeweilige Herkunftssprache mit den Kindern. Untereinander sprechen wir Englisch.
Sowohl unsere Tochter (unser älteres Kind) als auch unser Sohn sind in Deutschland geboren, haben ihre ersten Lebensjahre aber in Frankreich verbracht. Beide Kinder waren seit Beginn ihres Lebens mit drei Sprachen konfrontiert und fingen erst spät an zu sprechen, etwa im Alter von zwei Jahren. Das war in etwa der Zeitpunkt, als sie in einen französischen Kindergarten kamen. Obwohl ich sehr viel Zeit mit ihnen verbrachte und ausschließlich Bulgarisch mit ihnen sprach, waren ihre ersten Worte Französisch.
Unsere Tochter konnte sehr früh zwischen den Sprachen unterscheiden. Sie hat zu den drei Umgangssprachen zwischendurch immer wieder Deutsch gehört, z.B. wenn wir uns mit deutschen Freunden getroffen haben. Als wir in der Zeit einmal zu Besuch in Deutschland waren, hat sie dann von sich aus ein Kind auf Deutsch angesprochen, obwohl wir nicht in Deutschland lebten und zuhause kein Deutsch sprachen – das hat uns sehr überrascht.
Ab ihrem dritten Lebensjahr besuchte unsere Tochter ein école maternelle, der französische Kindergarten, der jedoch einen starken Bildungsfokus hat. In dieser Zeit wurde ihr Französisch immer besser. Sie hat im Französischen den kanadischen Akzent ihres Vaters nicht übernommen und war demnach von den französischen Kindern beim Sprechen nicht zu unterscheiden. Weiterhin haben wir sie mit vier Jahren zu einem ein-monatigen Englisch-Sommercamp angemeldet. Hier hat sich ihr Englisch, was sie ja zuhause durch die Kommunikation mit meinem Mann mitbekam, sehr verbessert.
In unserer Zeit in Frankreich waren wir oft in Deutschland. Unsere Ferien verbrachten wir in Kanada oder Bulgarien, außerdem kam meine Mutter oft aus Bulgarien zu Besuch. Unsere Kinder konnten also alle Sprachen auch mit anderen Personen sprechen und direkt im Land anwenden.
„Ich würde insbesondere Eltern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist empfehlen, ihre Kinder in den Kindergarten zu bringen“
Unsere Kinder hatten zwar immer Kontakt zum Deutschen, durch Freunde oder Aufenthalte in Deutschland, aber richtig angefangen Deutsch zu lernen haben sie, als wir nach Deutschland zurückgegangen sind. Für unseren Sohn haben wir uns, anstatt für einen staatlichen Kindergarten für einen Kinderladen entschieden – das war ein Fehler. Die Kinder entwickeln meiner Ansicht nach dort zwar sehr gute soziale Kompetenzen, allerdings fehlte die intellektuelle Förderung. Vor allem Dinge wie Feinmotorik, Sprache etc. wurden nicht von den Kindern gefordert – ganz im Gegensatz dazu wie dies im école maternelle bei meiner Tochter in Frankreich der Fall war. Ich würde insbesondere Eltern, deren Muttersprach nicht Deutsch ist empfehlen, die Kinder in Kindergärten zu bringen, weil dort der Bildungsauftrag stärker umgesetzt wird. Da unsere Tochter noch in Frankreich in den Kindergarten gegangen ist, der ein stark schulisches System mit klarem Bildungsauftrag hat, konnten wir die Unterschiede sehr genau beobachten.
Unsere Tochter ist in Deutschland in eine Vorschule gekommen, die sich durch eine sehr gemischte Schülerschaft auszeichnete. Sie konnte in weniger als zwei Monaten gutes Deutsch sprechen. Unser Sohn hat länger gebraucht um Deutsch zu lernen, aber die Voraussetzungen im Kinderladen waren auch nicht so gut, wie bei unserer Tochter. Als es um den Übergang in die Schule ging, haben wir uns dann bei unserer Tochter für eine Schule mit einem Mathematikprofil entschieden. Dort hatte sie allerdings nur unregelmäßige Förderung für Deutsch als Zweitsprache und ich war nach einer Weile erschrocken, wie schlecht sie las. Ich habe sofort angefangen mit ihr auch zu Hause zu üben, um das auszugleichen.
„Sprechen Sie mit ihren Kindern die Sprache, in der Sie sich am wohlsten fühlen und den besten Zugang zu ihrem Kind haben“
Wir wollten eigentlich weiterhin alle Sprachen bei unseren Kindern fördern, haben aber irgendwann gemerkt, dass vor allem die Deutschförderung sehr wichtig ist, wenn sie hier etwas erreichen wollen. Daher habe ich meinen Kindern erlaubt, mit mir auch Deutsch zu sprechen. Heute würde ich das als Fehler bezeichnen und auch anderen Eltern davon abraten. Sprechen Sie mit ihren Kindern die Sprache, in der Sie sich am wohlsten fühlen und den besten Zugang zu ihrem Kind haben.
Zusätzlich zur deutschen Schule besuchte unsere Tochter vier Stunden in der Woche eine bulgarische Schule, in der gleichen Zeit ging unser Sohn in einen bulgarischen Kindergarten. Unser Sohn hat in der Schule wesentlich größere Schwierigkeiten als unsere Tochter. Durch die fehlende Vorbereitung im Kindergartenalter ist er mit ganz anderen Voraussetzungen in die Grundschule gekommen als viele andere Kinder. Zurzeit hat er nur eine Stunde Deutschförderung pro Woche. Ich finde, dass das viel zu wenig ist und hier ein Bedarf an einem weiteren Ausbau besteht. Ich habe ihm jetzt auch eine bulgarische Lehrerin organisiert, weil ich möchte, dass sich sein Bulgarisch verbessert und hoffe, dass er durch das Erlernen der bulgarischen Sprache auch Fortschritte im Deutschen macht.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass in Deutschland bei Kindern, die mehrsprachig aufwachsen, eher fehlende Deutschkenntnisse als Defizit wahrgenommen werden und nicht die vielsprachigen Kenntnisse als Kompetenz. Ansonsten hat sich an unserer Sprachpraxis nur wenig geändert. Ich spreche immer noch hauptsächliche Bulgarisch mit den Kindern und mein Mann Französisch. Nur die Kinder sprechen untereinander jetzt Deutsch.
Wir haben unsere Kinder immer viel gefördert. Wir haben eine große Anzahl an Büchern und Filmen in Deutsch, Bulgarisch, Französisch und Englisch zu Hause. Dazu sind wir in den Sommerferien immer in Bulgarien und auch viel in Frankreich, wo unsere kanadischen Verwandten dann dazukommen. Dennoch sind wir zu weniger gekommen als wir wollten. Da es uns natürlich wichtig ist, dass unsere Kinder sehr gutes Deutsch sprechen, mussten wir in den anderen Sprachen Abstriche machen.
Ich sehe es auf jeden Fall als einen Vorteil, dass unsere Kinder so viele Sprachen sprechen, weil sie dadurch Einblicke in verschiedene Kulturen erhalten. Sie wachsen mehrsprachig und multikulturell auf. Viele Leute denken, dass unsere Kinder später auf dem Arbeitsmarkt Vorteile haben, weil sie so viele Sprachen sprechen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, das wird sicher auch von dem Beruf abhängen, den sie wählen.
Als eine letzte Empfehlung würde ich Eltern noch raten, neben den eigenen Sprachen Deutsch sehr stark von den Kindern zu fordern. Vor allem auch schon vor der Schule.
Portrait eines Dozenten für Interkulturelle Kommunikation
Der nachfolgend porträtierte Herr arbeitet als Dozent für Interkulturelle Kommunikation. In diesem Rahmen gibt er Seminare zum Thema interkulturelle Kompetenz in der Arbeitswelt. Diese Seminare werden z. B. von Angestellten der Stadt Hamburg, der Polizei und den Kundenzentren besucht, die merken, dass ihre eigenen Kompetenzen nicht ausreichen, sie sind meist monolingual.
Seine Muttersprache ist Deutsch, die erste Fremdsprache in der Schule war Englisch. Dann lernte er in der Schule Französisch und Latein, in der 11. Klasse nahm er an einem Schüleraustausch nach Frankreich teil und vertiefte dort seine Sprachkenntnisse. In der 7. Klasse fing er aus Langeweile an, Spanisch zu lernen. Mit 11 wollte er Arabisch lernen, aber seine Eltern meinten, er solle zuerst Hebräisch lernen. Im Studium der Islamwissenschaft in Hamburg und Kairo lernte er Arabisch und Persisch. Vor 10 Jahren lernte er einen Brasilianer kennen und lernte Portugiesisch bzw. Nord-Ost Brasilianisch (erste "erworbene" Sprache). Er erlernte einen ausgeprägten Dialekt, was nicht der Standardvarietät entspricht, wie es bei den anderen Sprachen der Fall ist. Vor einigen Jahren lernte er West-Grönländisch (Sprache der Inuit). Er hat das Gefühl, dass das Erlernen dieser noch einmal neuen Sprache (West-Grönländisch) seine interkulturellen Kompetenzen geschult hat. Er sagt:
„Mit jeder Sprache erweitert sich mein Weltwissen",
er habe ökonomische und soziale Strukturen kennengelernt.
Sein Vater spricht sehr gut Französisch, seine Mutter Schwedisch und Englisch. Seine Mutter hat auch ein bisschen Schwedisch mit ihm gesprochen, als er Kind war.
Sprache ist in seinen Seminaren zentral, seine Sprachkompetenz holt die Teilnehmer ab, er wirkt besonders kompetent, wenn er verschiedene Sprachen spricht. Wenn er Hocharabisch spricht und Passagen aus dem Koran zitiert, merkt er, dass die Teilnehmer ihm auch in anderen Dingen folgen, da ist jemand, der sich sehr intensiv mit einer Kultur auseinandergesetzt hat, was einen größeren Zeitaufwand beinhaltet als lediglich angelesenes Wissen. Er nutzt Sprache auch zum Auflockern oder um Motivation zu schaffen. Z. B. vergleicht er Sprachen miteinander und bringt den Teilnehmern bestimmte Basics bei, wobei Sprachangst/Hemmungen verloren gehen,
„man schlüpft in die Schuhe des anderen“.
Er nutzt bestimmte Sprachen mehr im Arbeitskontext (Arabisch), manche Sprachen benutzt er im Alltag (Portugiesisch) und andere sind ein Hobby (West-Grönländisch). Seine Kompetenzen unterscheiden sich auch in den Sprachen. Z. B. im Wortschatz in bestimmten Bereichen, manchmal kennt er ein Wort nur auf Deutsch und EINER anderen Sprache. Aber seine Kompetenzen sind auch sehr dynamisch, manchmal passiert es, dass er eine Sprache besser lernt, wenn Nachfrage besteht.
Er benutzt seine unterschiedlichen Sprachen auch im Alltag und im Privaten. Er hat dann einen besseren Zugang zu Personen, die andere Sprachen sprechen (besonders Portugiesisch, sogar eine Portugiesische Bank). Manchmal ist er so auch ein Teil einer Parallelgesellschaft.
Er habe definitiv Vorteile in der Arbeitswelt durch Mehrsprachigkeit und seiner Begeisterung für Sprachen, direkt nach dem Studium hat er wegen dieser Begeisterung seinen ersten Job als Assistent eines Professors bekommen.
Er hat auf jeden Fall das Gefühl, dass Personen, z. B. in Kundenzentren bessere Karrierechancen haben, wenn sie mehrsprachige Kompetenzen haben, da unsere Gesellschaft sich immer weiter verändert. Er hält Türkisch, Arabisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch und Russisch für entscheidend. Und bezeichnet Behörden und Ämter als eine „Sprachinsel des Deutschen“. Mehrsprachige Personen sind weniger auf Dolmetscher angewiesen, haben weniger Reibungsverluste und können mehr Vorgänge abarbeiten und somit seien sie effizienter und haben so vermutlich auch bessere Aufstiegschancen (bspw. im öffentlichen Dienst).
Für Arbeitgeber ist es manchmal vielleicht sogar teurer, wenn sie nicht wissen was ihre Mitarbeiter für Sprachen sprechen, sie bezahlen jemanden, der bestimmte Märkte erschließen, obwohl sie schon einen Mitarbeiter haben, der die Sprache spricht. Aber für viele Jobs wird nur ein bestimmtes Profil abgefragt und anderes interessiert nicht, das Unternehmen gibt sozusagen nur Geld für eine bestimmte Leistung aus. Unternehmen bräuchten, um die Mehrsprachigkeit ihrer Mitarbeiter zu erfassen, eine riesige Personalabteilung Trotzdem wäre die Weiterbildung der Mehrsprachigkeit der Mitarbeiter auf bestimmten Gebieten sicherlich hilfreich und nützlich für das Unternehmen, oft legen Unternehmen darauf aber keinen Wert und meinen, ihre Angestellten könnten sich in der Freizeit weiterbilden.
Er hat auf jeden Fall das Gefühl, dass er selbst durch Mehrsprachigkeit offener und flexibler geworden ist. Doch bei bilingual aufgewachsenen Personen ist es nicht immer so, dass sie automatisch zwischen den Kulturen „wechseln“ können. Sie haben oft das Potenzial, aber dieses muss noch angeleitet werden. Manchmal führt Mehrsprachigkeit aber auch zu weniger Toleranz bzw. einem kritischeren Blick gegenüber Kulturen, die nicht die „eigenen“ sind.
In Hamburg (vielleicht sogar in Deutschland) sei Englisch so etwas wie eine „Killersprache“, für andere Sprachen, aber auch für den Erwerb des Deutschen, weil Deutsche oft ins Englisch wechseln, wenn sie merken, dass jemand Defizite im Deutschen hat. In der Arbeitswelt geht es um Effizienz, da ist es manchmal einfacher, Englisch zu sprechen. Schon vom schulischen Kontext an sollte Kindern mitgegeben werden, dass sie eine tolle Ressource mit sich tragen und selbstbewusst zu sein, damit sie mit dieser Haltung auch in die Arbeitswelt treten.
Man könnte sich viel mehr an anderen mehrsprachigen Personen orientieren, zum Beispiel Personen aus anderen mehrsprachigen Kontexten als Berater einbeziehen (z. B. Afrika). Erfahrungswerte von diesen Gesellschaften können genutzt werden, auch von Einzelpersonen.
Eine italienische Mutter erzählt, wie ihre Kinder in Deutschland Italienisch lernen
Ich komme aus Italien, mein Mann aus Deutschland. Wir haben zwei Töchter und leben in Norddeutschland.
Mit meinen Kindern spreche ich immer Italienisch, egal in welcher Situation. Da gibt es keine Ausnahmen, auch wenn Menschen dabei sind, die kein Italienisch sprechen. Der Besuch muss das mitmachen. Mein Mann kann nur ein kleines bisschen Italienisch sprechen, er versteht es größtenteils. Mit ihm spreche ich Deutsch, aber mit meinen Kindern nur Italienisch, auch, wenn er dabei ist. Unsere Kinder sprechen Deutsch mit ihrem Vater. Untereinander unterhalten sie sich auch auf Deutsch. Ich selber spreche gut Deutsch und unterrichte Italienisch. Ich mische die Sprachen sehr selten. Wenn meine Töchter beispielsweise ein Wort auf Deutsch sagen, frage ich sie auf Italienisch, was sie meinen. Ich erlaube keine Mischungen der Sprachen, außer bei Wörtern, die es im Italienischen nicht gibt. Unsere Töchter wissen das und machen mit. Wenn andere Leute dabei sind, zum Beispiel Freundinnen meiner Töchter, übersetzen die Kinder.
"Neben der Nutzung des Italienischen in der Familie hatten die Kinder seit dem Kindergarten Italienischunterricht".
Meine Töchter hatten seit dem Kindergartenalter durchgehend Italienischunterricht, im Kindergarten waren es 1,5 Stunden täglich durch eine Lehrerin im Kindergarten. Das war uns sehr wichtig, ich habe die beiden extra in diesen Kindergarten gefahren, obwohl er etwas weiter weg war.
Unsere Jüngere ist im Moment in der Grundschule, die Ältere ist letztes Jahr auf das Gymnasium gekommen. Ihre Schule hat nun einen Lehrer gefunden, der dort Italienischunterricht gibt, der Kurs dauert zwei Stunden pro Woche, immer mittwochs nach der Schule. Ich habe mich zusammen mit anderen Eltern für diese Einrichtung engagiert. Der Kurs, den sie vorher besuchte fand auch einmal die Woche statt, an einem Gymnasium. Die Schule hat freundlicherweise Räume zur Verfügung gestellt. Es handelte sich um einen Italienischkurs für deutsch-italienische Kinder, der Kurs wurde von der Stadt organisiert. Die Kinder kamen von verschiedenen Schulen für den Italienischunterricht an eine Schule. Das Angebot an dieser Schule wurde vor Kurzem eingestellt. Ich bin mit dem Unterrichtsangebot für unsere Kinder sehr zufrieden! Ich würde es schön finden, wenn vielleicht ein paar mehr Medien mit einbezogen würden, zum Beispiel ein paar Filme geguckt werden oder sie sogar mal ein Theaterstück besuchen würden. Der Lehrer ist sehr offen für die Anregungen von uns Eltern, ich finde, es ist ein guter Austausch untereinander. Das Gymnasium unserer Großen ist wirklich eine besondere Schule.
Generell finde ich, dass in der Schule die Herkunftssprachen der Schülerinnen und Schüler gefördert werden sollten. Es sollte ein Angebot zum Lernen geschaffen werden, zum Beispiel, indem sich die Schulen zusammentun und die Schülerinnen und Schüler so die Möglichkeit bekommen, ihre Herkunftssprache zu erlernen (Französisch sollte an Schule A, Farsi an Schule B usw. gelehrt werden). Dazu müssten sich die Schulen untereinander vernetzen, was zurzeit leider noch fehlt.
Interview mit einer deutsch-/ türkischsprachigen Mitarbeiterin eines Finanzamts
Welche Sprachen sprichst du?
Ich bin mehrsprachig. Ich wurde bilingual erzogen, in Deutsch und Türkisch. Das Deutsch meiner Eltern war nicht gut, aber sie haben uns Kinder immer ermutigt, Deutsch zu sprechen. Z.B. hat mein Vater ein Spiel mit uns gespielt als wir Kinder waren: Wir haben die Nachrichten auf Deutsch geguckt und sollten sie dann für meinen Vater ins Türkische übersetzen. Dann hat er unser Deutsch korrigiert. Wir haben nie darüber nachgedacht, dass er das eigentlich gar nicht konnte, da er nicht so gut Deutsch sprach - das war nur ein Trick von ihm, um uns Sprachen nah zu bringen.
Ich spreche außerdem fließend Englisch, ein bisschen Arabisch, ein bisschen Azerbaijanisch und ein bisschen Alt-Osmanisch. Gerade lerne ich Spanisch.
Hast du das Gefühl, dass dir deine Mehrsprachigkeit dabei hilft, andere Sprachen zu lernen?
Ich denke schon. Ich leite ehrenamtlich Kurse, in denen Erwachsene mit Migrationshintergrund angeregt werden, auf Deutsch zu kommunizieren. Dort sind viele Sprachen präsent. Ich merke, dass ich Wörter aus der Persischen Sprache verstehen kann. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Gemeinsamkeiten zwischen den Sprachen bestehen.
Es hilft mir weiterhin Spanisch zu lernen. Ich verstehe viele Wörter auf Anhieb und kann auf ähnliche Wörter und Strukturen aus anderen Sprachen zurückgreifen.
Welche Sprachen sind in deinem Alltag präsent?
Zu Hause spreche ich Deutsch, Türkisch und Englisch. Ich versuche so oft wie möglich in meiner Freizeit Englisch zu üben. Bei meiner Arbeit ist Deutsch klar überrepräsentiert, aber ich muss auch Abläufe auf Englisch bewerkstelligen.
Du bist in Deutschland geboren. Wie beurteilst du die Mehrsprachigkeit der 2. Generation?
Die junge türkische Generation in Deutschland kann sehr gut Deutsch sprechen. Hier gibt es eher das Problem, dass ihr Türkisch verloren geht. Das Deutsch-Türkisch ist wie ein Dialekt des Türkischen, es hat sogar neue grammatische Strukturen. Es ist sehr schwer, mehrsprachig aufzuwachsen und beide Sprachen gleich gut zu sprechen. Nicht Viele schaffen das… es ist wichtig, wieviel Unterstützung man von seinen Eltern bekommt und was für Freundeskreise man hat.
Findest du, dass in deiner Stadt (Hamburg) Mehrsprachigkeit unterstützt und wertgeschätzt wird?
Ich nehme schon wahr, dass die Stadt versucht, Mehrsprachigkeit als etwas Positives hervorzuheben und etwas zu unternehmen. Aber es gibt auch viele komische Situationen im Alltag... vor zwei Jahren habe ich begonnen, in der Finanzbehörde zu arbeiten und - wie kann ich das am besten ausdrücken - ich war das neue Tier im Zoo… Die Kollegen fanden mich sehr interessant. Am Anfang wussten sie nicht, wie sie mit mir umgehen sollten. Dann haben sie herausgefunden, dass ich Deutsch sprach und sie sagten mir „ah du sprichst Deutsch! Wir hatten Angst, du würdest nichts verstehen“, aber ich habe das nicht als Beleidigung empfunden, ich habe nur gedacht: Schade, dass solche Vorurteile noch bestehen.
Aber ich finde schon, dass die Stadt Hamburg einen Versuch unternimmt, Mehrsprachigkeit zu unterstützen. Behördenmitarbeiter(innen), die in Kontakt mit Ausländern sind, können Sprachkurse besuchen. Die Stadt Hamburg stellt speziell Auszubildende mit Migrationshintergrund ein, um ihre Mehrsprachigkeit für die Stadt zu nutzen.
Welchen Vorteil hat deine Mehrsprachigkeit für dich?
Ich sehe den Vorteil bei meiner Arbeit. Ich bin sensibilisierter in der persönlichen Beziehung mit meinen Kollegen. Ich bin offener und nicht so erstaunt über die Besonderheiten meiner Kollegen. Vorteile gibt es auch im Umgang mit Konflikten. Mehrsprachige Personen können eher Kompromisse eingehen und die konkurrierenden Parteien zusammen bringen. Sie finden Argumente für beide Seiten.
Mehrere Sprachen bringen mehr Erfahrungen mit sich. Wenn du Sprachen sprichst, kannst du den Dialog mit Menschen finden, mit denen du normalerweise nicht sprechen würdest. In meiner Abteilung gibt es keinen, der auf Englisch korrespondieren kann und deshalb erledige ich die ausländische Korrespondenz. Hätten wir türkische Kontakte, würde ich auch die Kommunikation mit ihnen übernehmen.
Auch in meinem Privatleben werde ich oft angefragt, bei Übersetzungen zu helfen.
Wenn du eine Sache in Bezug auf Mehrsprachigkeit in deiner Stadt ändern könntest…
Dann gäbe es Übersetzungsmöglichkeiten an allen öffentlichen Schildern. Du könntest einfach einen Knopf drücken und die Übersetzung in deiner Sprache wird dir angezeigt. Das würde das Zusammenleben erleichtern. Ich glaube nicht, dass es Leute davon abhalten würde, Deutsch zu lernen.
Interview mit einem deutsch-/ polnischsprachigen Lehramtsstudenten zum eigenen mehrsprachigen Aufwachsen und zur Förderung von Mehrsprachigkeit
Welche Sprachen sprichst du?
Meine Muttersprachen sind Deutsch und Polnisch. Als Fremdsprachen spreche ich Spanisch und Englisch, bei diesen Sprachen muss ich nicht mehr nachdenken.
Ich lese Bücher auf Französisch, aber das aktive Sprechen ist nicht so gut, Französisch kann ich besser versehen. Mein Russisch wird besser und besser.
Dann kann ich noch slawische Sprachen verstehen, wie z.B. Slowenisch, Slowakisch, Tschechisch, Ukrainisch
Wie ist das Verhältnis Deutsch/ Polnisch?
Für mich trifft es tatsächlich zu, dass ich beide Sprachen gleich gut beherrsche. Das ist aber äußerst schwierig und kommt selten vor. Es ist sehr wichtig die Herkunftssprache zu pflegen, wenn man in Deutschland lebt, da man viel öfter Deutsch spricht. Ich versuche in beiden Sprachen zu lesen und zu schreiben. Ich habe viel Kontakt zum Polnischen in meinem Alltag, z.B. in meinem Studentenwohnheim mit Studenten aus Polen, mit meinen Eltern etc.
Wieso kommt es, dass du beide Sprachen gleich gut beherrscht?
Du musst beide Sprachen trainieren und du musst in beiden Sprachen Zugang zu bestimmten Themenfeldern bekommen. Z.B. gehst du in Deutschland zur Schule und zur Uni, dann ist dein Vokabular in diesen Themen im Deutschen viel besser ausgeprägt und im Polnischen musst du es dir erst erarbeiten. Du musst Polnische Filme angucken, die auch Slang beinhalten, fachspezifische Bücher lesen…
Glaubst du, Mehrsprachigkeit hat einen Vorteil? Wenn Ja, welchen?
Ich glaube, es kann einen Vorteil aber auch Nachteil bedeuten, es hängt davon ab, wie du die Sprachen entwickelst und ob du sie auseinanderhalten kannst. Wenn du ein Bewusstsein für Sprachen entwickelst und wenn du in der Lage bist, zwischen den Sprachen zu wechseln und beide gleich gut sprichst, ist es ein großer Vorteil. Du erreichst damit zwei Welten und zwei Denksysteme.
Aber wenn das nicht passiert, kann es auch von Nachteil sein. Es gibt Personen, die beide Sprachen nicht ausreichend sprechen und sich in keiner der beiden Kulturen zu Hause fühlen.
Aus einer linguistischen Perspektive sehe ich es so: wir bauen uns ein linguistisches System in unserem Kopf auf, je nachdem, wie die Sprache beschaffen ist, die wir sprechen. Wir internalisieren die Systematik der Sprache und das beeinflusst unsere Art zu denken, z.B. sind im Deutschen Verb und Hilfsverb voneinander getrennt und das Verb steht am Ende des Satzes. Also macht man schon während der Formulierung des Satzes einen Blick hin zum Ende des Satzes. Oder die Großschreibung im Deutschen. Es hat sich in unseren Kopf eingeprägt, dass wir Wörter in Subjekte kategorisieren und diese automatisch großschreiben. Wir denken in den Kategorien Subjekt, Verb, Objekt. In anderen Sprachen existieren diese Kategorien z.B. gar nicht. Es anderes Beispiel wäre die Unterscheidung von männlichen und weiblichen Wörtern oder belebten und unbelebten Wörtern. Das sind Denkkategorien, die durch das linguistische System einer Sprache entstanden sind und unser Denken beeinflussen.
In der Arbeitswelt stellt Mehrsprachigkeit ganz klar einen Vorteil dar, Mehrsprachige verfügen über mind. zwei Sprachen und entsprechend auch über einen Zugang zu den Kulturen, das führt zu größerer Toleranz und Empathie. Es ist leichter, das Neue und Andere zu akzeptieren, da man mit diesen Aspekten vertraut ist.
Im Zeitalter des globalen Handels hat Mehrsprachigkeit praktische Vorteile. Man kann dort Arbeit finden, wo die vorhandenen Sprachen gebraucht werden
Hast du das Gefühl, dass dir deine Mehrsprachigkeit geholfen hat andere Sprachen zu lernen oder besondere Erfahrungen zu machen?
Es hat mir auf jeden Fall beim Sprachenlernen geholfen und vor Allem beim Reisen.
Es hilft mir schnell Hürden zu überwinden und neue Leute kennen zu lernen. Menschen werden freundlicher, wenn sie merken, dass du ihre Sprache ein wenig beherrscht.
Ich habe auch mal als Übersetzer für Polnisch gearbeitet und viele Dinge gelernt und interessante Menschen kennen gelernt.
Als wie hoch schätzt du den Vorteil von Mehrsprachigkeit auf dem Arbeitsmarkt ein?
Ich wünschte, es wäre noch wichtiger auf dem Arbeitsmarkt aber Sprache ist nur ein Medium um Inhalte zu transportieren. Zuallererst musst du etwas zu sagen haben, es besteht kein Sinn darin „Nichts“ ins verschiedenen Sprachen zu sagen. Was man braucht, ist eine Basisqualifikation und dann sind Sprachen ein Plus, um diese Qualifikationen in verschiedenen Sprachen einzubringen.
Findest du, dass in deiner Stadt (Hamburg) Mehrsprachigkeit geschätzt wird?
“Jein”. Ich bin schon ein wenig herum gekommen in meinem Leben und konnte Hamburg mit anderen Städten und Ländern vergleichen. In einer globalen Perspektive steht Hamburg nicht schlecht dar, aber es könnte sich noch mehr engagieren, man könnte immer mehr tun…es gibt Städte, in denen noch mehr Sprachen präsent sind und Mehrsprachigkeit viel weniger geschätzt wird.
Ein Beispiel aus dem Bildungsbereich: die Sprachbewusstheit der Schüler(innen) könnte viel mehr im Sprachunterricht genutzt werden: Die Lehrer könnten auf die vorhandenen sprachlichen Ressourcen der Schüler(innen) zurückgreifen, wenn sie eine neue Sprache unterrichten. Wenn du z.B. Spanisch unterrichtest, kannst du auf das Sprachpotential/ das Sprachverständnis von frankophonen Schülern zurückgreifen. Eine italienisch-, portugiesisch-, rumänisch- oder französischsprechende Person könnte einen Spanier verstehen, ohne viel Spanisch gelernt zu haben, indem man das Vokabular und die Regeln transferiert. Diese Methode könnte man schulen. Lehrer könnten Schüler(inne)n zeigen, wie sie sich selbst-organisieren und Muster wiedererkennen. Das ist auch mit anderen europäischen Sprachen möglich, auch wenn die Sprachen nicht miteinander verwandt sind. Man könnte z.B. Fremdwörter nehmen und sie vergleichen. Selbst im Polnischen und Russischen gibt es Fremdwörtern aus dem Lateinischen, die im Spanischen benutzt werden.
Wenn du eine Sache in Bezug auf Sprache in deiner Stadt ändern könntest…
Wir haben hier viele Medien in anderen Sprachen (Zeitungen, Bücher etc.) aber ich vermisse diese Vielfalt im Fernsehen. Es gibt türkische Sender, aber nur die Türken können sie verstehen. Ich wünschte es gäbe Untertitel für alle Sendungen in ausländischen Sprachen.
Als Lehramtsstudent bin ich der Gefahr ausgesetzt, eine Art Clique mit den polnisch sprechenden Schüler(inne)n zu bilden, wenn ich sie wiederholt polnisch mit ihnen spreche. Ich mache das natürlich um ihr Sprachpotential anzuregen und zu fördern, ich wünschte aber ich könnte dies tun ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, das Polnische zu bevorzugen.
Wenn du eine Sache in deiner Sprachbiographie ändern könntest…
Wenn ich noch einmal in der Schule wäre, hätte ich eine viel größere Motivation Sprachen zu lernen. Außer Englisch hatte ich noch Französisch in der Schule und ich habe es abgewählt (ich hatte einen schlechten Lehrer). Damals habe ich den Mehrwert von Fremdsprachen nicht erkannt. Außerdem hatten wir damals schlechtere Bedingungen als heute, wir haben erst angefangen Englisch in der 5. Klasse zu lernen, heut lernen sie es schon ab der 1., der Tatsache Rechnung tragend, dass man als Kind viel besser Sprachen lernt. Für die zweite Fremdsprache konnte man bei uns nur zwischen Latein, Französisch und Russisch wählen. Wir konnten uns weder auf Sprachen spezialisieren, noch exotische Sprachen, wie Chinesisch oder Türkisch, lernen. Hätte man diese Sprachen damals konsequent verfolgt, hätte man nun, Jahre später, viele Vorteile davon gehabt.